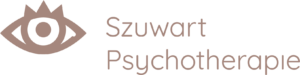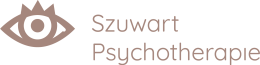Was ist eine Panikattacke?
Panik im Sinne einer Erkrankung bzw. einer Panikstörungen zeichnen sich durch wiederkehrende Panikattacken aus, die plötzlich und unerwartet auftreten, ohne dass sie an bestimmte Auslöser wie Situationen oder Objekte gebunden sind. Betroffene erleben während dieser Attacken eine extreme Angst, die häufig mit intensiven körperlichen Symptomen einhergeht. Diese können von Herzrasen, Schwindel und Atemnot bis hin zu Taubheitsgefühlen, Übelkeit oder Hitzewallungen reichen. Besonders prägend ist die Angst vor dem Kontrollverlust oder sogar dem Sterben.
Da die Panikattacken jederzeit und ohne Vorwarnung auftreten können, entwickeln viele Betroffene Vermeidungsverhalten und Sicherheitsbedürfnisse, was oft erhebliche Einschränkungen im Alltag und Berufsleben mit sich bringt. Schätzungen zufolge erleiden 3 bis 5 % der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens eine Panikstörung, während etwa 9 % mindestens einmal eine Panikattacke erleben. Frauen sind dabei doppelt so häufig betroffen wie Männer.
Diagnose: Panikstörung?
Die Diagnose einer Panikstörung wird laut ICD-10 gestellt, wenn wiederholte Panikattacken auftreten, die nicht durch bestimmte Situationen oder Objekte ausgelöst werden und meist spontan auftreten. Diese Anfälle sind in der Regel unvorhersehbar und treten nicht in lebensbedrohlichen oder besonders anstrengenden Momenten auf.
Eine Panikattacke zeichnet sich durch eine Episode intensiver Angst aus, die plötzlich einsetzt und schnell ihr Maximum erreicht. Die Attacke dauert in der Regel einige Minuten, und mindestens vier der folgenden Symptome müssen vorhanden sein:
- Vegetative Symptome wie Herzklopfen, Schweißausbrüche, Zittern oder Mundtrockenheit.
- Atembeschwerden, Engegefühl in der Brust, Brustschmerzen oder Übelkeit.
- Schwindel, Benommenheit, das Gefühl von Unwirklichkeit oder die Angst, die Kontrolle zu verlieren.
- Allgemeine Symptome wie Hitzewallungen, Kälteschauer oder Kribbeln.
Die Diagnose sollte immer von einem erfahrenen Arzt oder Psychotherapeuten gestellt werden, der den Betroffenen durch Beratung und Behandlung unterstützt.
Ursachen bzw. Auslöser einer Panikstörung
Panikstörungen entstehen häufig durch einen Kreislauf aus körperlichen und emotionalen Reaktionen. Betroffene achten verstärkt auf körperliche Symptome, was zu einer Steigerung der Angst führt, die sich in weiteren körperlichen Beschwerden wie Herzrasen oder Atemnot ausdrückt. Dieser Teufelskreis verstärkt sich selbst und kann zu weiteren Panikattacken führen.
Die Ursachen für Panikstörungen sind vielfältig und beinhalten sowohl biologische als auch psychologische Faktoren. Genetische Veranlagung sowie frühere Erfahrungen mit unvorhersehbaren und unkontrollierbaren Ereignissen spielen eine wichtige Rolle. Auslöser können zudem körperliche Belastungen, der Konsum von Koffein oder extreme Temperaturen sein.
Behandlung und Therapie
Panikstörungen sind gut behandelbar, vor allem durch psychotherapeutische Ansätze, deren Wirksamkeit wissenschaftlich belegt ist. Ein Therapieansatz ist die kognitive Verhaltenstherapie. In dieser werden die Betroffenen dabei unterstützt, negative Gedankenmuster zu erkennen und diese zu hinterfragen. Falsche Interpretationen von Körpersymptomen, die oft zur Aufrechterhaltung der Panikattacken führen, werden dabei gezielt verändert.
Ein zentraler Bestandteil der Therapie ist zudem die Expositionstherapie, bei der Betroffene bewusst angstauslösenden Situationen ausgesetzt werden. Dadurch wird das Vermeidungsverhalten durchbrochen, und Betroffene lernen, ihre Ängste besser zu bewältigen. Ergänzend dazu kommen Entspannungsverfahren wie Atemübungen und progressive Muskelentspannung (PMR) zum Einsatz, um Panikattacken vorzubeugen und den Umgang mit körperlichen Symptomen zu erleichtern.
Tiefenpsychologische und Analytische Therapieverfahren beziehen sich eher auf die Ursachen und sind ebenfalls wirksam. Sie wirken oft sogar nachhaltiger.
Mögliche Ziele der Therapie
Die Behandlung einer Panikstörung verfolgt mehrere Ziele:
- Förderung eines besseren Verständnisses für die Erkrankung und Aufbau einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung.
- Vermittlung von Wissen über die Störung (Psychoedukation) und Entwicklung eines individuellen Erklärungsmodells.
- Veränderung von angstauslösenden Gedanken.
- Ggf. Erlernen von Entspannungsmethoden, wie z.B. progressive Muskelentspannung oder autogenes Training.
- Ggf. Durchführung von Verhaltensexperimenten und Expositionstherapie zur Reduktion des Vermeidungsverhaltens.
- Rückfallprophylaxe zur Stabilisierung der Therapieerfolge und Verhinderung erneuter Panikattacken.
Mit einer gut strukturierten Therapie kann die Lebensqualität der Betroffenen erheblich verbessert und die Angst vor zukünftigen Panikattacken langfristig reduziert werden.